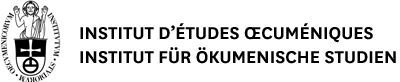Lebenslauf
Undatiert; Transkription aus dem Privatarchiv der Familie Nigg.
veröffentlicht in: Walter Nigg, Ein Wörtlein über meine Bücher und weitere autobiographische Texte, Fribourg 2010, 15-21.
Es fällt mir nicht leicht, über den Gang meines Lebens zu berichten. In der Kürze, mit der dies hier geschehen müsste, bliebe auch vieles unverständlich. Aus diesem und anderen Gründen möchte ich davon absehen und lediglich einige Episoden daraus erwähnen, die für meine Entwicklung zur Theologie von entscheidender Bedeutung waren.
I.
Geboren 6. Januar 1903 in Luzern. Mein Vater war Postverwalter und stammte aus einer streng katholischen Familie. Meine Geschwister wurden deshalb in der katholischen Kirche getauft. Nur ich als „Spätling" wurde nach der Konfession meiner Mutter in der reformierten Kirche getauft. Obgleich mich konfessionelle Fragen von frühester Jugend an umgaben, war der Religionsunterricht von keinem nachhaltigen Einfluss auf meine Entwicklung. Abgesehen davon, dass er mir von Zeit zu Zeit einen moralischen Impuls gab, mich zu Hause behilflich zu zeigen, habe ich die Religionsstunden ohne Abneigung und ohne Freude über mich ergehen lassen. Sie rieselten an mir herunter wie Wasser am Felsen.
Von ganz anderer Wirkung auf mein Inneres waren die schweren Dinge, die sich in meinem Elternhaus zutrugen und die meine ganze Kindheit unter einen beständigen Schatten und Druck stellten. Nach dem frühen Tod meines Vaters (1914) lebte ich zwei Jahre in sehr bedrängter Lage allein mit meiner Mutter zusammen. Trotz der Not jener Tage kann ich an diese Zeit mit nicht genügend dankbarer Erinnerung zurückdenken. Wenn ich es auch damals nicht vollauf begriff, so habe ich doch in jener Zeit erfahren, was Mutterliebe, die sich für ihre Kinder aufzehrt und aufopfert, im Leben bedeutet. Ich stehe nicht an zu sagen, dass ich, was ich den „character indelebilis" bezeichnen möchte, ganz allein meiner Mutter verdanke, die mir nicht in Worten, aber durch ein Leben voll Enttäuschung und Entbehrung vorlebte, was Liebe, Güte und Duldersinn ist. Sie war es, die mir auf ihrem Sterbelager das Versprechen abnahm, „ein guter Mensch zu werden".
II.
Nach dem Tode meiner Mutter (1916) wurde ich zu dem Bruder meines Vaters nach Zug gebracht, dessen Familie ich bis dahin der verschiedenen Konfession wegen nie gesehen hatte. Meine neue Tante kam mir mit großer Freundlichkeit entgegen, und ihr wohlsituiertes Haus verfehlte nach meinen zweijährigen Entbehrungen nicht seinen Eindruck auf mich. Doch glaubte sie erst dann ihrer Christenpflicht Genüge getan zu haben, wenn sie nicht nur für mein leibliches Wohl, sondern auch für mein Seelenheil gesorgt habe. Da sowohl sie als ihr Mann infolge ihres aussergewöhnlich strengen Katholizismus an starken religiösen Depressionen und Skrupeln litten, begann nun, um das ketzerische Gift in mir auszutreiben, eine Prozedur, die ich als reine religiöse Quälerei empfand. Ich wurde in Messen und Herz-Jesu-Andachten usw. mitgenommen und zuletzt zu einem Pater in einen Einzel-Religionsunterricht gegeben. Diese ganze religiöse Sphäre verfehlte ihre Wirkung auf meine Phantasie nicht. Ich weiss nicht, wie es mir auf die Dauer ergangen wäre, wenn jener Pater seine Bekehrungsversuche nicht so plump und unpsychologisch angestellt hätte. Sicher ist, dass ich ihm nicht überlegen war, und was auf dem Spiele stand, verstand ich auch nicht ganz. Genug, dass mein Widerspruchsgeist wuchs, je weniger ich mich wehren konnte und je unerträglicher mir die düstere und freudlose Luft im Hause meines Onkels wurde, bis mir das Dasein dort so verhasst war, dass ich eines Tages, nachdem ich meine Verwandten belogen hatte, auf und davon fuhr nach Zürich (1917).
III.
In Zürich ging es mir schlecht. Mein Geld hatte ich bald mit Büchern und anderen Dingen verbraucht. Die Not zwang mich, meinen Unterhalt zu verdienen, und da ich noch nichts gelernt hatte, verdingte ich mich als Ausläufer. Ich hatte in jenen Tagen oft Hunger, und am Abend waren meine Füsse wund von dem vielen und ungewohnten Gehen. Nun erwachten meine Skrupel: ist das die Strafe dafür, dass du in Zug die Wahrheit nicht angenommen hast? Ist es dir dort nicht unvergleichlich besser ergangen als jetzt? Und so betete ich denn in meiner Verlassenheit zur „Mutter Gottes", sie solle sich mir offenbaren, wenn ich katholisch werden soll; aber sie offenbarte sich mir nicht. Dagegen ging mir etwas anderes auf.
In dem Geschäft, in welchem ich arbeitete, war noch ein anderer, älterer Ausläufer, der sich meiner annahm und mich zum „Christlichen Verein junger Männer" führte. Dort interessierte man sich sofort für mich, und dieses Interesse tat mir wohl. Klein und gedemütigt durch meine Verhältnisse, stand ich so recht unter den Bedingungen, um mich dem Pietismus rückhaltlos hinzugeben. Er diente mir zur Rechtfertigung für mein Verhalten gegenüber dem Katholizismus und wurde mir zum Halt in meinen Jünglingsjahren. So ging ich denn in Bibelstunden und Gebetsstunden, hörte Evangelisationsvorträge und sang Hallelujahlieder. Ich besuchte kein Kino und kein Theater, trank keinen Alkohol und rauchte keine Zigarette, bekehrte mich und hätte am liebsten die ganze Welt mitbekehrt. – Es war mir mit meinem Pietismus ernst, und ich möchte hinzufügen, dass ich diese Phase in meinem Leben nicht missen möchte. Es war der Pietismus, der mich mit der Bibel, die ich bis dahin nur vom Hörensagen kannte, bekannt gemacht und mir das ganze Christentum konkret und persönlich nahe gebracht hat. Seit jener Zeit ist mir das Religiöse nie mehr aus den Augen entschwunden und zur Hauptfrage meines Lebens geworden.
IV.
Meine Wanderschaft führte mich nach einem Jahr, in welchem es mich noch reichlich herumgeschlagen hatte, schliesslich zu einer Stelle auf dem Betriebsbüro der Viscose-Fabrik in Emmenbrücke, wo ich rund zwei Jahre (1918–1920) tätig war.
Ich war damals noch ein überzeugter Pietist. Doch obwohl ich mich in Zürich bekehrt hatte, stiegen mir bald Zweifel auf, ob jene Bekehrung auch eine echte gewesen sei. Wohl hatte ich Stunden, in denen ich nur so schwamm in Gefühlen und die Gnade auf mich niederträufeln fühlte. Aber es gab auch andere Stunden, in denen mir alles, Sündenvergebung und Besitz des heiligen Geistes, fraglich wurde, und nichts meinen frommen Wünschen Genüge tun konnte. So war ich trotz meinem vermeintlichen Geborgensein ein unbefriedigter und zerrissener Mensch, der der Tretmühle des Himmelhoch-jauchzend und Zu-Tode-betrübt rettungslos ausgeliefert war.
Zu diesem seelischen Prozess kam nun der unmittelbare Eindruck, den die Fabrik, das Arbeiterleben und der Sozialismus auf mich machten, eine für mich vollständig neue Welt, von der mir in meinem bürgerlichen Heim nie etwas zu Gesicht gekommen war. Es ist verständlich, dass auch dieser Einfluss gewaltig auf mich wirkte und mich einfach „umwarf". Die widersprechendsten Gedanken und Bestrebungen durchzogen mich und ich hätte mich in diesem Wirrwarr kaum zurecht gefunden, wenn ich in jener Zeit nicht mit den Schriften Hermann Kutters bekannt geworden wäre.
Ich verschlang damals Kutters Bücher mit wahrem Heisshunger. Er hat mir den Weg zur Überwindung des Pietismus gezeigt. Namentlich sind mir das aufgeschlossene und vorwärts drängende Wesen seiner Persönlichkeit, sein leidenschaftlicher und glühender Protest gegen Kirche und Gesellschaft usw. sehr nahe gegangen. Seine Schriften wurden für mich zu einer wahrhaften Befreiung aus engen Mauern.
Kutter gab mir aber zudem die Anleitung, den Sozialismus zu verstehen, ohne das Christentum aufgeben zu müssen. Er hat mir die Möglichkeit geschaffen, auch dieser Bewegung und den Fragen, die sie den heutigen Menschen stellt, offen gegenüber zu treten. Darum wurde mir die Zeit meines Fabrikaufenthaltes zu einer Gelegenheit, unermesslich viel zu lernen. Vor allem kam ich dabei dem Volk nahe wie nie mehr seither und lernte mich in die Mentalität und Empfindungsweise des Arbeiters hineinzuversetzen, gewann ein Verständnis für ihr schweres Dasein mit all seinen Leiden und Sorgen. Obgleich ich mich nie dazu entschliessen konnte, mich auch politisch in die Reihen der Arbeiter zu stellen, so geht mir doch das Dasein des arbeitenden Volkes auch heute noch unmittelbar nahe und sei es auch nur als beständiges „schlechtes Gewissen", das ich habe und das mich nicht zur Ruhe kommen lässt gegenüber ihrer Existenz.
V.
Wenn ich nun zum Schlusse noch etwas über meine Studien auf der Universität sagen soll, so fühle ich deutlich, dass mir diese Zeit noch so nahe steht und ich noch so wenig Distanz von ihr gewonnen habe, dass ich sie auch noch nicht klar und abgeschlossen überschaue. Deshalb kann ich dieser Zeit noch nicht objektiv gegenüber treten und ist das, was ich darüber zu sagen habe, nicht anders zu verstehen denn als ein vorläufiger Rechenschaftsversuch.
Wenn ich mir heute, nachdem ich fünf Jahre auf der Universität zugebracht habe, versuche darüber klar zu werden, was das Bedeutendste und Wertvollste dieser Zeit für mich war, so muss ich ohne Zögern antworten: es ist das Bekanntwerden mit der Wissenschaft, konkreter gesprochen, mit der Historie. Es versteht sich nach meiner religiösen Entwicklung von selbst, dass ich mit einem starken Vorurteil gegen die „gottlose Wissenschaft" die Universität bezog. Kutter versuchte, mir dieses Misstrauen in persönlichen Gesprächen auszureden; unbewusst war es aber trotzdem wirksam und zwar bedeutend stärker als ich mir damals selbst eingestand. Dass ich mich von der Notwendigkeit und Unumgänglichkeit der wissenschaftlichen Probleme nicht nur überzeugte, sondern sie heute als einen Teil meiner eigenen Fragestellung betrachte, das ist es, was ich vor allem der Universität verdanke. Ich verstehe dies folgendermassen:
Ich hatte von meiner Schulzeit her ein lebhaftes Interesse an der Geschichte. Vom ersten Semester an beschäftigte ich mich vorwiegend mit der Kirchengeschichte als der Disziplin, die mir während meines ganzen Studiums am meisten Freude bereitete. Nun war diese Beschäftigung mit der Kirchengeschichte zunächst einfach der Ausfluss meines Interesses an dem Reichtum und der Mannigfaltigkeit religiöser Gestalten und Möglichkeiten. Im Laufe dieser Beschäftigung aber erwuchsen mir daraus ganz andere Probleme. Es war die Frage der Methode, die sich mir bei der Vergleichung verschiedener Darstellungen der Kirchengeschichte aufdrängte, und an ihr ging mir das Wesen der Wissenschaft auf. Nicht von einem Tag zum andern wurde es mir klar, aber in einem langsamen Prozess, den ich auch jetzt noch nicht als abgeschlossen betrachte, dass, wenn schon historisch gefragt und geforscht werden soll, es sich nur um eine sogenannte wertfreie Forschung handeln kann. Darunter verstehe ich eine Forschung, die – weil es keine absolut voraussetzungslose Wissenschaft geben kann – wenigstens sich bemüht, nach Möglichkeit jede Tendenz auszuschalten, die vom Willen beherrscht ist, frei zu sein von jeder Bindung, die sich in Zucht nimmt, ihren eigenen Standpunkt nicht immer mit dem Stoff zu vermengen. In dieser Richtung denke ich mir auch meine weitere Beschäftigung mit der Kirchengeschichte.
Diese Art des Eingehens auf die Historie hat mich jedoch in eine gewisse Spannung zu meiner religiösen Einstellung gebracht. Ich will es nicht verschweigen, dass mir diese Spannung schon schwere Stunden bereitete. Trotzdem möchte ich nicht, sie wäre nicht vorhanden. Einerseits weil ich glaube, dass sie einfach nicht zu umgehen ist, und andererseits weil sie mich davor bewahrt hat, in Selbstsicherheit zu erstarren.
Walter Nigg