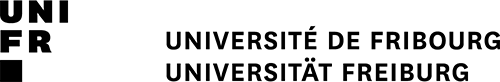InterviewPublikationsdatum 10.12.2019
Geisteswissenschaftliche Forschung im Verwertbarkeits-Diskurs
Dr. Sonja Schüler, Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Dienststelle Forschungsförderung der Universität Fribourg im Gespräch mit Dr. Markus Zürcher, Historiker, Generalsekretär und Mitglied der Geschäftsleitung Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern über die Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften in Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung.
Herr Dr. Zürcher, kann man feststellen, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften in der Wissenschaftslandschaft und damit auch in der Forschungsförderung der Schweiz eine ganz besondere Rolle innehaben?
Ja, diese besondere Rolle ist feststellbar: Ich habe den Eindruck, dass gegenwärtig die ganze Forschungsförderung, die Wissenschaftspolitik ausgerichtet ist auf Innovation, und zwar Innovation, die unmittelbar "verwertet" werden kann, und diese Verwertung geht meistens dahin, dass es Patente braucht. Das ist das Wesentliche, und das misst man ja auch sehr stark: Eine erfolgreiche Forschung ist letztlich das, was zu einer Anwendung führt, die patentiert werden kann. Und solches gibt es in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht. Auch wenn wir soziale Innovationen machen, also beispielsweise neue Formen der Kinderbetreuung, neue Formen des Zusammenlebens, das Wohnen, die Gleichstellungsdiskurse, all diese Dinge lassen sich nicht patentieren.
Wir haben viele Baustellen, und diese werden laufend diskutiert, und damit wird etwas verändert, aber das wird nicht den Geistes- und Sozialwissenschaften zugeschrieben, sondern man tut, als käme das irgendwie von selbst...Und das ist die Problematik, dass dann die eigentliche Bedeutung und der Wert der Geistes- und Sozialwissenschaften nicht richtig wahrgenommen werden, weil sie nicht so ausgewiesen werden können wie dies in den exakten Wissenschaften der Fall ist. Ja, ich denke, dies ist ein grosses Problem.
Die Förderlogiken der grossen nationalen und internationalen Förderakteure wie des Schweizerischen Nationalfonds oder der Europäischen Union richten sich wahrnehmbar an der Prämisse der messbaren Verwertbarkeit aus. Gleichzeitig verfügt die Schweiz aber auch über einen vielfältigen Sektor privater Stiftungen, von denen sich nicht wenige der Wissenschaftsförderung widmen und die mitunter weniger starr definierte Förderbedingungen haben als die grossen, öffentlichen Akteure. Stellt die Forschungsförderung durch private, "unkonventionelle" Mittel nicht gerade für die Geistes- und Sozialwissenschaftler, die ja im Gegensatz zu Forschenden der exakten Wissenschaften häufig Forschungen in weitaus geringerem finanziellen Rahmen betreiben, ein unterschätztes Potenzial der Wissenschaftsförderung dar?
Wir haben glücklicherweise in der Schweiz eine grosse Anzahl von Stiftungen. Die Problematik im Bereich der Stiftungen ist, dass sie sich meistens auf einen bestimmten Bereich konzentrieren; sei das Kunst, Denkmal- oder Landschaftspflege... Es gibt meist keine breiten thematischen Bereiche, innerhalb derer man eingeben kann. Das ist ein Faktor. Der andere besteht darin, dass Stiftungen gerne mitwirken, und dies zunehmend. Gerade neuere Stiftungen sind meistens von Persönlichkeiten gegründet worden, die wirklich ein bestimmtes Anliegen haben, beispielsweise zeitgenössische Kunst...Und selbstverständlich kann man diese Stiftungen anschreiben, aber man muss geklärt haben, dass man dem jeweiligen Profil entspricht. Es gibt ja einige, die ganz offen sind, aber die Zahl der Stiftungen, die klare Ziele und klare Themenbereiche hat, ist gross. Und natürlich variiert der Umfang der Mittel, die man von diesen Stiftungen bekommt, sehr stark.
Mir fallen zwei grössere Stiftungen ein – die Gebert Rüf Stiftung und die Landis & Gyr Stiftung – die sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zunehmend zu Förderakteuren mit klar definierten eigenen Themenschwerpunkten und gezieltem eigenem Engagement entwickelt haben.
Genau. Sie wollen ein Profil haben und gegen Aussen auftreten können. Die lange verbreitete Idee, dass man als Stiftung sehr verschwiegen war und eigentlich nicht die Öffentlichkeit suchte und Bescheidenheit demonstrierte, das ist nicht mehr die vorherrschende Mentalität im Stiftungsbereich. Sie wollen nach Aussen auftreten und ihre Ziele und Themen kontinuierlich verfolgen. Und entsprechend sind diese Fördergefässe wichtig, aber sie passen nicht immer zu den Anliegen, die Forschende haben.
Sehen Sie ein Potenzial, dass sich Stiftungen stärker als Förderakteure in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsförderung profilieren und etablieren könnten?
Es gibt ja diesen Verband aller Stifter, die sich auch regelmässig treffen... Sicher gäbe es Möglichkeiten, an einer solchen Versammlung einmal Anliegen der Forschungsförderung für Geistes- und Sozialwissenschaftler aufzuwerfen. Ein anderes Potenzial von Interesse sehe ich in allem, was unter dem Titel social innovations läuft. Ich habe den Eindruck, dass das kommt und dass man das immer deutlicher spürt, und dort könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich mehr bewegen könnte. Ich sehe das auch bei grösseren Stiftungen, die beispielsweise im Liegenschaftsbereich unterwegs sind und wo Interesse besteht, bei grossen Arealen: Wie bringt man wirklich die Bewohner zusammen? Wie kommt man zu einer Art caring community? Es muss ja nicht gleich caring sein, aber dass man es wirklich hinkriegt, dass so etwas geschieht wie eine Solidargemeinschaft, dass man wirklich miteinander ins Gespräch kommt, eine Dienstleistung entwickelt... Da ist jetzt Vieles unterwegs, aber eher in Richtung der Sozialwissenschaften und weniger in den Geisteswissenschaften.
Hier stellt sich auch die Frage nach den Anforderungen an das Dienstleistungsangebot der Dienststellen für Forschungsförderung der Universitäten: Wie können universitäts-interne, aber auch übergeordnete Dienststellen und Akteure die Geistes- und Sozialwissenschaftler beim Zugang zu Fördermitteln in Zukunft effektiver unterstützen? Meine Befragungen unter Forschenden der Universität Fribourg hierzu haben ergeben, dass sich viele eine stärker personalisierte Beratung durch Berater mit Fachkenntnissen wünschen, wenn es um die Vorbereitung von Mittelanträgen und die Erfüllung von Förderkriterien geht. Auch der Wunsch nach Foren der interdisziplinären Vernetzung und der Öffentlichkeits- und "Identitätsarbeit" zur Identifikation gemeinsamer Probleme und Forderungen und zur Beratung über Möglichkeiten und Kanäle der Aussen-Kommunikation an Politik und Gesellschaft ist verbreitet. Gleichzeitig spüre ich immer wieder den Geist von verschlossenen, sich abgrenzenden, individualistischen "gated communities" mit eigener Wissenschaftskultur und einer starken Zurückhaltung gegenüber der Option der Auseinandersetzung mit potenziellen Zielgruppen ausserhalb der eigenen fach- und themenspezifischen Netzwerke.
Ich kann sicher zustimmen, dass wir in den Geistes- und Sozialwissenschaften einen ausgeprägt starken Individualismus haben. Auch dort ist natürlich die Konkurrenz hoch, aber ich würde dennoch sagen, dass in den exakten Wissenschaften mehr in Gruppen gearbeitet wird und man Teams bildet, man bearbeitet einen Aspekt eines grösseren Problems. Bei den geistes- und Sozialwissenschaften ist es sehr selten, und entsprechend hat man die Tendenz, dass man sein Thema oder die Problematik oder das besondere, das man untersuchen will, gar nicht gerne gegen Aussen kommuniziert, weil man die Furcht hat, irgendjemand könnte das dann abkupfern. Und das ist die ganze Karriere, die dann läuft... In den Geistes- und Sozialwissenschaftlern ist es einfach die Person mit ihren Qualifikationsarbeiten, und es wird nicht daran gedacht, dass eigentlich hinter allen diesen Fortschritten, die man macht, letztlich eine Art Kollektiv steht. Ja, man war in den Seminaren usw., aber man sieht das so nicht und man hat eher die Befürchtung Einer könnte mir zuvorkommen oder solche Dinge...Es wäre sehr wichtig, dieses Denken aufzubrechen, zu verändern. Meine Erfahrung war immer, dass, wenn man eine Thematik bearbeitet und die Arbeit öffentlich macht und Kollegen darauf hinweist, dann bekommt man sehr viele Hinweise. Ich habe es nie erlebt, dass ein Kollege irgendetwas abgekupfert hat, sondern im Gegenteil...nein, mir wurde gesagt, Hier ist noch etwas zu beachten... Man müsste eine gewisse Offenheit hinkriegen, das wäre sicher wichtig.
Was ich auch als wichtig erachte ist, wir haben ja mehrere hundert Stiftungen, und deshalb denke ich wirklich, dass die universitären Beratungsstellen sehr wichtig sind, und es wäre wichtig, dass die Personen, die dort arbeiten, genügend Zeit haben, sehr gezielt auszuwählen und zu schauen, welche Stiftung kommt infrage...Dann wäre es auch sinnvoll, wenn eben mehrere Forschende in cluster gebracht werden könnten, wo man sagt, die gehen in eine ähnliche Richtung, und dann mit ihnen einen Runden Tisch machen und ihnen sagen, das sind eure Stiftungen...Dies müsste viel mehr gemanagt werden als wenn jeder einfach auf eine website geht und schaut, was sind die Vorgaben, und versucht es einfach mal...Dann stelle ich auch fest, dass die Stiftungen zunehmend mitreden wollen und nicht einfach Gesuche entgegennehmen. Mir ist bekannt, dass mehrere Stiftungen so eine Art round table gemeinsam organisieren, das heisst, dass drei, vier, fünf Stiftungen, die im Bereich unterwegs sind, sich absprechen und überlegen, Wo sind unsere Prioritäten.
Und es wäre natürlich auch wertvoll, wenn man Stiftungen identifiziert und die mal einlädt und ihnen sagt, Wir haben hier einen Kreis von Forschenden, die interessiert sind, die dann so zusammenfügen...und dort ist es dann schon auch so, die Stiftungen wollen mitreden, und das ist dann die Problematik, also wenn einfach eine Person Geld braucht für ihr Projekt, das sie gerade macht, vielleicht für eine Qualifikationsarbeit, dann ist natürlich absolut kein Spielraum mehr da, und dann ist natürlich die Chance, dass man durchkommt, noch geringer. Viel besser wäre es, wenn wir fünf Geisteswissenschaftler hätten und dann einige Stiftungen einladen, und dann mit ihnen versuchen, das Ganze aufzugleisen. Gemeinsam zu entwickeln. Das geht natürlich schlecht für Qualifikationsarbeiten, aber für die freie Forschung, für Projekte sollte man heute zusammengehen mit diesen Stiftungen, die schon interessiert sind, wohin es gehen soll.
Es gibt ja einige Akteure, die etwa im Bereich Klimafragen unterwegs sind, ich denke jetzt mal, hier in Bern ist da die Schweizerische Mobiliarversicherung bedeutsam. Und ich bin ziemlich sicher, dass alles, was mit Naturgefahren zu tun hat, was den Klimawandel anbelangt, ein Kernthema für sie ist, denn sie sind ja betroffen als Mobiliarversicherung... Ich bin sicher, da werden Projekte vorbereitet zwischen Praktikern, also beispielsweise im Hochwasserschutz, Forschenden und den Mobiliar-Leuten. Da sind der Geldgeber, die öffentliche Hand, der Umsetzer und die Forschung involviert. Solche Konstellationen wären gut auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Das führt dann gerade für Fachhochschulen zum Ziel...Das ist natürlich eine anwendungsorientierte Forschung, es ist eine Dienstleistungsforschung und nicht freie Forschung. Dies beinhaltet die Bereitschaft, dass man auf bestimmte Dinge, die den Forschenden wichtig sind, verzichten muss, damit man die Erwartungen des Geldgebers besser abdecken kann.
Ich komme auf die Bedeutung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Wissenschaftskultur und der öffentlichen Verwertbarkeits-Diskurse zurück. Besteht nicht das grosse ungenutzte Schlüsselpotenzial für ein effektives Hinterfragen dieser Verwertbarkeits- und Legitimitätsdiskurse, und letztendlich auch für problemorientierte Veränderungen in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsförderungs-Politik in einer Öffnung der geistes- und sozialwissenschaftlichen "gated communities"?
Ich habe trotz allem den Eindruck, dass in der breiten Bevölkerung und auch auf kantonaler Stufe bei den Politikern und den zuständigen Ämtern man davon ausgehen kann, dass durchaus die Bedeutung geistes- und sozialwissenschaftlicher Arbeit gesehen wird. Man finanziert weiterhin die Museen, man erkennt, dass Städte nur noch von Interesse sind, wenn man ein Kulturleben mit entsprechenden Angeboten hat. Diese Personen sind sich im Klaren, dass es wesentlich ist, dass ein kunsthistorisches Museum, ein historisches Museum...Ich stelle fest, dass Universitätsangehörige doch an ganz vielen Orten Vorträge halten usw.
Eine ganz andere Seite sind die Förderorganisationen. Die grossen, offiziellen Förderorganisationen wie der Nationalfonds sehen sich wiederum in internationaler Konkurrenz, und da wird eben gewissermassen geschaut, Kommt diese Forschung in irgendeiner Weise in ein Ranking?, und all das, was darunter ist, was aber für die Bevölkerung und die Politik weit wichtiger ist, das ist einfach unter diesem Radar. Und dort sehe ich die grosse Problematik. Der Autor André Holenstein etwa erzeugt durch sein Buch Mitten in Europa eine ganz andere, sehr realistische Vorstellung der Schweiz, dass letztendlich die Schweiz entstanden ist aus Zufällen...ich meine, das ist wirklich ein mindchange...Er konnte das auch dem Bundesrat vorstellen...Aber das schlägt sich nirgends in Statistiken nieder. Eine vollkommen andere, neue Denkweise dessen, was die Schweiz darstellt. Da müssen wir einfach schauen, dass wir vernünftigere Beurteilungskriterien dessen haben, was sich nicht zählen und schon gar nicht patentieren lässt, aber auch nicht Zitationen...Das Buch zum Beispiel ist einfach etwas, das die Schweiz betrifft, vielleicht noch einige im Ausland, die sich auch für die Schweiz interessieren ...Das, was wir tun, ist einfach in einem ganz anderen Bereich als das, was wir messen, und ich denke daran, wir haben ja eine kleine Broschüre gemacht: Qualität statt Quantität. Sie zielt genau auf darauf, es geht um die Relevanz. Es geht nicht um Zitationen und solche Dinge...
...Und auch nicht um eine gewaltige Menge an Publikationen, die man praktisch aus dem Boden stampfen muss...
...Und 50% davon werden gar nicht erst gelesen...Ich würde sagen, dass man in diesem Wissenschaftssystem immer noch diesem New Public Management – Ansatz anhängt mit Zählen und Indikatoren...Das passt zunehmend schlecht zu dem, was wir eigentlich bräuchten, und bestraft werden die Geistes- und Sozialwissenschaften...
...Und dies entspricht auch gar nicht der eigentlichen historischen Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern untergräbt sogar diese Rolle und die damit verbundenen spezifischen Arbeitslogiken...
...Genau. Und all diese Programme, die die Universitäten haben, für die Bevölkerung, und dass man mal hier und mal dort ist, das kommt wirklich sehr gut an. Dies merke ich beispielsweise im Kanton Bern. Klar, wie haben natürlich die Hauptstadt mit ihrer Uni...Aber sie treten auch in Langenthal auf, in Langnau...und in all diesen mittelgrossen Gemeinden und kleinen Städten kommt das sehr sehr gut an, weil man immer noch dort eine community hat, die solche Anlässe gerne durchführt. Und die Bevölkerung kommt, weil eben nicht ein Riesenangebot da ist wie etwa in Zürich oder auch hier in Bern...
Ich denke dennoch, diese Diskurse müssten noch stärker geprägt werden von den Forschenden selbst, anstatt sich zu verbiegen, um in die Förderschemata der grossen Förderakteure zu passen. Dazu müsste auch mehr Zusammenarbeit stattfinden, die auch die institutionelle Ebene der Universitäten einschliesst...
Ja...Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der ganz ein schwieriger ist und sich vielfach nachweisen lässt: Dieser "öffentliche Gelehrte", das kann sehr sehr gefährlich werden in dem Sinne, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen der Anerkennung, der Reputation intern und extern. Beispielsweise in der Schweiz ist der Soziologe Jean Ziegler, um einen Namen zu nennen, im akademischen Bereich ganz weit unten. Er gibt Meinungen von sich und da ist nicht alles wirklich sauber hinterlegt, aber in der Öffentlichkeit der Schweiz ist der top... Wenn man noch vor zehn Jahren gefragt hätte, Kennen Sie einen Soziologen in der Schweiz?, dann war das Jean Ziegler. In dieser Unterscheidung zwischen dem "öffentlichen" und dem "internen" Gelehrten ist eine riesige Distanz, ein riesiger Unterschied, da wird ganz anders beurteilt. Die traurige Geschichte ist: Intellektuelle, Forschende, Gelehrte, die öffentlich auftreten, riskieren einiges, weil es einen gewissen Neid gibt. Dann, wenn man zur Öffentlichkeit spricht, dann muss man klare Aussagen machen, und die sind nicht immer zu 100% oder nicht genügend differenziert usw., dann kommt dieser Vorwurf. Hinzu kommt: Wenn man damit mal beginnt, dann wird man ständig angefragt, und dann zu jedem Thema. Das haben mir mehrfach Journalisten bestätigt: In der Uni Zürich etwa rufen die immer die gleichen drei Personen an, und wenn man da einmal drin ist, dann ist die Situation, dass sie einen fragen von den Hooligans, über dieses und jenes, und wenn das dann die Kollegen sehen, Ah, jetzt hat er etwas gesagt über littering, jetzt über Hooligans, dann über die Fans..., dann verliert er als "Universalgenie" bei den Kollegen sehr rasch die Reputation. Viele wollen das gar nicht erst machen, weil sie nicht bereit sind, die Dinge zu vereinfachen, weil sie wissen, wenn sie vereinfachen, dann kommen die anderen und sagen, Hey, hier stimmts nicht, da stimmts nicht. Man hat eigentlich keine wirklichen Anreize, in die Öffentlichkeit zu gehen, solange man noch in der Karriereentwicklung ist. Dann, wenn man ein gut installierter Ordinarius ist, dann kann man das, aber sonst nicht, dann ist es ein Nachteil.
Ich bin kein Professor, aber ich hatte auch schon solche Phasen, wo ich angefragt wurde zu einem Thema, dann habe ich mich auch geäussert, und es fällt dann gleich auf, dass in den nächsten drei Wochen weitere Anfragen kommen, die wohl inhaltlich noch in der Nähe sind, aber nicht mehr wirklich, und wo man sich dann eingestehen muss, Ich weiss dazu auch nicht mehr, als jedermann, der Zeitung liest...Dann ist man plötzlich in einer ganz dummen Situation, wo einem unterstellt werden kann, Der hat offensichtlich ein Profilierungsproblem, und da besteht das Risiko: Wenn man die Öffentlichkeit sucht, dann besteht doch ein Risiko, dass es intern nicht positiv angenommen wird.
Vielleicht wäre es eine geeignetere Option, in Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, mit den Akademien, den Universitäten, den Fakultäten oder auch mit politischen Akteuren, die die artikulierten Interessen der Forschenden in den öffentlichen Diskurs tragen.
Ja. Genau.
Herr Dr. Zürcher, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.