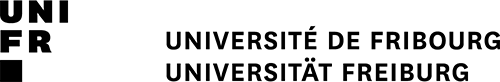Publikationsdatum 31.03.2020
Das Wort des Dekans, Mariano Delgado - FS 2020/II
Theologie in Zeiten des Coronavirus
Liebe Freunde, liebe Freundinnen und liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät!
Auf den ersten Blick sind es keine guten Zeiten für die Theologie: geschlossene Kirchen, keine Karfreitags- und Osterliturgie… der alte, einsame Papst in Rom, der in einer scheinbar pathetischen Geste vor dem leeren Petersplatz mit der Monstranz in der Hand „der Stadt und dem Erdkreis“, der gesamten Menschheit, den Segen erteilt und verkündet, dass wir alle in einem Boot sitzen, dass Gott den Menschen nicht verlassen wird, ja, nicht verlassen kann, hat er ihn doch gleichsam als seinen Gesprächspartner geschaffen: „Zum Dialog mit Gott (ad colloquium cum Deo) ist der Mensch schon von seinem Ursprung her aufgerufen: er existiert nämlich nur, weil er, von Gott aus Liebe geschaffen, immer aus Liebe erhalten wird (a Deo ex amore creatus, semper ex amore conservatur)“ (Gaudium es spes 19). In Zeiten wie diesen ist nicht nur Gott, der immer wieder nach dem Menschen fragt: „Wo bist du?“ (Gen 3,10). Auch der Mensch ruft aus der Tiefe zu Gott: „Wo bist du?“
Gewiss, es fehlen nicht die Seelsorger, die, wie einst ein Carlo Borromeo, in Spitälern und an anderen Orten präsent sind, um spirituellen Trost und Beistand zu spenden. Aber die Helden unserer Zeit sind die Sanitäter und das Medizinpersonal, die selbstlos zu helfen versuchen und dabei ihr Leben riskieren. Wir können darin ein säkulares Erbe der christlich geprägten Kultur der Barmherzigkeit sehen, auf deren Boden einst die Spitäler, die Armen- und Altersheime entstanden sind: Seien wir froh, dass in diesem Bereich die christliche Botschaft so fruchtbar war! Ähnliches gilt für das Denken der „einen“ Welt und der „einen“ Menschheitsfamilie“, das selbstverständlich geworden ist und das in Zeiten von Katastrophen eine Welle globaler Solidarität entfacht. Wir werden für das Coronavirus einen hohen – menschlichen und wirtschaftlichen – Preis bezahlen. Aber wir werden diese Krise auch überwinden, wie dies andere Male der Fall war. Die Frage ist nur, ob wir daraus lernen und endlich eine Kehre machen.
Nach ähnlichen Krisen, die uns „Demut“ und „Selbsterkenntnis“ sowie eine neue Lebensart hätten lehren sollen, machte die Menschheit einen Sprung und verfiel dem Stolz der Hybris: so folgte der schwarzen Pest des 14. Jahrhunderts die Renaissance, wo der Mensch sich als Krone der Schöpfung verstand, zur Ausbeutung der Natur berufen. Dem Dreissigjährigen Krieg und den Epidemien des 17. und 18. folgte die Aufklärung mit dem kant’schen „sapere aude“ („habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“) und dem technischen Positivismus des 19. Jahrhunderts. Den Weltkriegen und den Epidemien des 20. Jahrhunderts folgten die Raumfahrt und die technologisch-digitale Revolution. Was wird nun kommen?
Soll für die Menschheit und die einzelnen Länder, die miteinander wirtschaftlich konkurrieren, weiterhin die Devise der olympischen Spiele „citius, altius, fortius“ (schneller, höher, stärker) gelten? Oder ist es endlich Zeit für eine Kehre, wie sie der „Club of Rome“ 1972 mit seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ und Papst Franziskus 2015 mit der Enzyklika „Laudato si‘“ anmahnten? Darin heisst es, der Mensch habe heute „keine solide Ethik, keine Kultur und Spiritualität …, die ihm wirklich Grenzen setzen und ihm in einer klaren Selbstbeschränkung zügeln» (Laudato si‘ 105). Es ist die Rede von einer „Spiritualität und Ästhetik der Genügsamkeit“, von einer Spiritualität „der Muße und des Festes, der Empfänglichkeit und der Unentgeltlichkeit“, von einem prophetischen und kontemplativen Lebensstil, von einem „Wachstum mit Mäßigkeit“, von einer „Rückkehr zu der Einfachheit“, von „Genügsamkeit und Demut“, von einem Abschied von der „Hochgeschwindigkeit“ unserer Zeit, von „der ständigen Hast“. Das wären einige Schritte zum gesuchten „neuen Humanismus“, der die Hybris hinter sich lässt und sich demütig in Selbsterkenntnis einübt.
Gefragt ist ein Humanismus, der, und sei es in säkularem Gewand, von den Grundwerten des Christentums geprägt ist: von der Sorge um ein „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) für alle, besonders für die Schwächsten, vom Aufbau einer Welt, in der Gerechtigkeit und Wahrheit, Freiheit und Frieden, Solidarität und Geschwisterlichkeit eine Heimat finden. Ein Humanismus, in dem wir Christen nicht vergessen, die universale Hoffnung auf die Rettung aller dank der unermesslichen, „freien“ Hingabe des menschgewordenen Gottes wachzuhalten.
Die Theologie ist heute dazu berufen, sich im Polyfon der Kulturen und Religionen der Welt an der Suche nach dieser neuen Spiritualität und diesem neuen Humanismus zu beteiligen. Die Welt nach dem Coronavirus darf nicht wieder von der verhängnisvollen Hybris geprägt sein! Diese schwere Prüfung muss endlich zu einer Kehre führen. Das möchte uns auch Hilde Domin mit ihrem Gedicht „Bitte“ zu verstehen geben:
Wir werden eingetaucht
und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen,
wir werden durchnässt
bis auf die Herzhaut.
Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht,
der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben,
taugt nicht.
Es taugt die Bitte,
dass bei Sonnenaufgang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe.
Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei,
dass noch die Blätter der Rose am Boden
eine leuchtende Krone bilden.
Und dass wir aus der Flut,
dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen
immer versehrter und immer heiler
stets von neuem
zu uns selbst
entlassen werden.
In diesen schweren Zeiten wünsche ich allen Freundinnen und Freunden sowie allen Mitgliedern der theologischen Fakultät ein besinnliches Ende der Fastenzeit und die universale Hoffnung auf die Auferstehung – verbunden mit dem Wunsch nach einer dauerhaften Kehre in unserer Lebensart.
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Mariano Delgado, Dekan